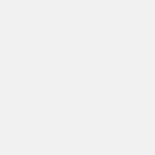1028
Francesco Albani, Christus und die Samariterin
Aufgeld oder Transportkosten sind in Ihrem Gebot nicht enthalten.
Durch die Abgabe Ihres Gebotes bestätigen Sie, die AGB von lot-tissimo.com und des entsprechenden Auktionshauses gelesen und akzeptiert zu haben. Ein Zuschlag verpflichtet zum Kauf.
Wählen Sie eine der folgenden Schnellgebotsoptionen:
Aufgeld oder Transportkosten sind in Ihrem Gebot nicht enthalten.
Durch die Abgabe Ihres Gebotes bestätigen Sie, die AGB von lot-tissimo.com und des entsprechenden Auktionshauses gelesen und akzeptiert zu haben. Ein Zuschlag verpflichtet zum Kauf.
Öl auf Kupfer. 39 x 29 cm.
Provenienz
Slg. Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, Paris. – Pierre-Louis de Reich de Pennautier, Paris/Versailles, 1711. – Philippe II. de Bourbon, Herzog von Orléans, Palais Royal, Paris. - Louis I. de Bourbon, Herzog von Orléans, Paris. – Durch Erbfolge an Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon, Herzog von Orléans. - Versteigerung Orléans-Sammlung, Auktion Michael Bryan, London, 26.12.1798, Lot 38 (unverkauft). - Auktion Peter Coxe, London, 14.2.1800, Lot 60 (an William Comyns, für 44,2 Pfund). - Slg. William Comyns, London. - Wohl The European Museum, Auktion, London, 25.3.1805. - Slg. Hastings Elwin, London. - Seine Versteigerung, Phillips, London, 6.6.1809, Lot 100. - Galerie Heim-Gairac, c. 1970. - Europäische Privatsammlung.
Literatur
L.-F. Dubois de Saint-Gelais: Description des Tableaux du Palais Royal avec La Vie des Peintres à la tête de leurs Ouvrages., Paris 1727, S. 134. – J. Couché: Galerie du Palais royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles qui la composent : avec un abrégé de la vie des peintres & une description historique de chaque tableau, Bd. 1, Paris 1786, o. S. - W. Buchanan: Memoires of Painting, with a Chronological History of the Importation of Pictures by the Great Masters into England since the French Revolution, London 1824, S. 89. – C. R. Puglisi: Francesco Albani, New Haven/London 1999, S. 131, Nr. 40.LV.a.
Der römische Barock war nicht nur die Epoche der großen Fresken und monumentalen Altargemälde, es war auch das Zeitalter der kleinformatigen Kabinettbilder auf Kupfer. Die Künstler der Bologneser Schule taten sich in diesem Fach besonders hervor, allen voran Guido Reni und Francesco Albani. Ein hervorragendes Beispiel der Kunst Albanis stellt das vorliegende Gemälde Christus und die Samariterin (Johannes, IV, 5-53) dar, außergewöhnlich aufgrund seiner Qualität wie auch seiner Provenienz: Lange Zeit, bis zur Französischen Revolution, befand es sich im Besitz der Herzöge von Orléans und war Bestandteil einer der prachtvollsten fürstlichen Kunstsammlung Europas, jener des Palais Royal in Paris.
Es war kein Zufall, dass vor allem junge Bologneser Künstler wie Reni und Albani die Malerei auf Kupfer im Rom des frühen Seicento populär machten. Sie lernten in der Werkstatt des Niederländers Denys Calvaert, der den jungen Italienern die Maltechnik weitergab, die in seiner Heimat verbreitet war. Die Malerei auf Kupfer zeichnete eine Leuchtkraft aus, die die Künstler auf Leinwänden und Holztafeln nicht erreichten. Im Rom des Barocks, in dem Fürsten und Kardinalnepoten um die besten Kunstwerke für ihre Sammlungen wetteiferten, wurden die Kabinettbilder auf Kupfer (wie auch jene auf Stein) zu begehrten Sammelobjekten. Ein beträchtlicher Anteil des frühen Schaffens von Albani in Bologna und Rom bildeten derartige Kabinettbilder (Puglisi, op. cit., passim). Das vorliegende Gemälde datiert Puglisi zwischen 1510 und 1517, als Albani das biblische Thema auch als großformatiges Gemälde behandelte (Albani kannte selbstverständlich Annibale Caraccis Interpretation), für einen der größten Mäzene in Rom, den Marchese Vincenzo Giustiniani (Kunsthistorisches Museum Wien, Inv.-Nr. 2698).
François Albane – Albani und Frankreich
Der französische Kunsthistoriograph André Félibien schreibt in seinen Entretiens (1672): Er [Albani] malte Gemälde von großer Schönheit, und ein jeder betrachtete sie mit Wohlgefallen, wie jene Andachtsbilder, die man in zahlreichen Kabinetten in Paris sieht… („Il eût fait des Tableaux d’une grande beauté, & que tout le monde eût pû regarder avec plaisir , comme sont ceux de devotion qu’on voit en plusieurs Cabinets de Paris…“). Und wie die französischen Fürsten die Werke Albanis sammelten! Der Klassizismus des Bologneser Barocks entsprach dem Geschmack des französischen Hochadels, der sich anschickte, in den neugegründeten Akademien die Sprache wie die Künste nach italienischem Vorbild zu erneuern. Francesco Albani war für die Franzosen, wie Annibale Caracci, der Inbegriff der klassischen Kunstauffassung der Bologneser Malerschule. Es waren dabei, wie Félibien berichtet, vor allem die fein gemalten Andachtsbilder wie Christus und die Samariterin, die es den fürstlichen Sammlern angetan hatten. Malvasia, der beste Kenner und Historiograph der Bologneser Malerschule, beobachtete mit Erstaunen, dass die Franzosen in Rom bereit waren, für ein kleines Kabinettbild Albanis mehr zu zahlen als für ein großes Werk von Reni. Der größte unter den Sammlern von Werken Albanis in Frankreich war der König höchstselbst: Ludwig XIV. besaß 21 Werke, darunter möglicherweise auch das kleine Selbstportrait des jungen Künstlers (Abb. 1), bei Lempertz versteigert, das etwa zeitgleich mit Christus und die Samariterin entstand, sich einst im Schloss von Versailles befand und – man ahnt es – auf Kupfer gemalt war.
Christus und die Samariterin in der Sammlung Orléans
Angesichts der immensen Wertschätzung des Werks von Albani in Frankreich war es naheliegend, dass die bedeutendste fürstliche Sammlung nach der des Königs, die Sammlung der Herzöge von Orléans im Palais Royal, ebenfalls einen großen Bestand seiner Werke besaß. Sie umfasste insgesamt neun Werke, darunter sieben Kabinettbilder auf Kupfer. Christus und die Samariterin wird in der Beschreibung der Sammlung von 1727 (Abb. 2) erwähnt, ebenso in der prachtvollen Publikation von 1786, mit einem Nachstich und einer Beschreibung, die die exquisite Qualität des Kupferbildes im Hinblick auf Komposition, Kolorit und Ausführung beschreibt: Diese Tafel, klug konzipiert, und mit Leichtigkeit gemalt, ist vor allem bemerkenswert aufgrund seines hervorragenden Kolorits (Ce Tableau, sagement pensé, et peint avec facilité, est remarquable sur tout par un excellent coloris; Couché 1786, op. cit.).
Während der französischen Revolution teilte Albanis kleine Kabinettbild das Schicksal der anderen Meisterwerke der Sammlung Orléans. Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon, Philippe Égalité, veräußerte einen beträchtlichen Teil an ein englisches Syndikat, die Werke wurden nach London verbracht und sukzessive versteigert. Zahlreiche Meisterwerke der italienischen Kunst in der neugegründeten National Gallery in London wie auch in aristokratischen Sammlungen in Großbritannien stammten aus der Sammlung, etwa Sebastiano del Piombos Auferweckung des Lazarus, bis heute die Inventarnummer Eins der National Gallery. Auch Christus und die Samariterin gelangte nach London und wechselte auf Auktionen kurz nacheinander den Besitzer, bevor sich seine Spuren verlieren. So ist Albanis Kabinettbild ein Zeugnis der fürstlichen Sammelleidenschaft in Frankreich, aber auch des Niedergangs des Ancien Régime und der Entstehung des modernen Auktionsmarktes im London des frühen 19. Jahrhunderts.
Abb. 1: Francesco Albani, Selbstportrait, ehemals Schloss von Versailles, Lempertz, 16.5.2015, Lot 1038.
Abb. 2: Jacques Couché: Galerie du Palais Royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles etc., Paris 1786.
Oil on copper. 39 x 29 cm.
Provenance
Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, Paris. - Pierre-Louis de Reich de Pennautier, Paris/Versailles, 1711. - Philippe II de Bourbon, Duke of Orléans, Palais Royal, Paris. - Louis I de Bourbon, Duke of Orléans, Paris. - By succession to Louis-Philippe II Joseph de Bourbon, Duke of Orléans. - Sale of the Orléans Collection, Michael Bryan auction, London, 26 December 1798, lot 38 (unsold). - Auction Peter Coxe, London, 14 February 1800, lot 60 (to William Comyns, for 44.2 pounds). - Coll. William Comyns, London. - Probably The European Museum, auction, London, 25.3.1805. - Coll. Hastings Elwin, London. - His sale, Phillips, London, 6 June 1809, lot 100. - Heim-Gairac Gallery, c. 1970. - European private collection.
Literature
L.-F. Dubois de Saint-Gelais: Description des Tableaux du Palais Royal avec La Vie des Peintres à la tête de leurs Ouvrages, Paris 1727, p. 134. - J. Couché: Galerie du Palais royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles qui la composent : avec un abrégé de la vie des peintres & une description historique de chaque tableau, vol. 1, Paris 1786, n. p. - W. Buchanan: Memoires of Painting, with a Chronological History of the Importation of Pictures by the Great Masters into England since the French Revolution, London 1824, p. 89. - C. R. Puglisi: Francesco Albani, New Haven/London 1999, p. 131, no. 40.LV.a.
The Roman Baroque was not only an era of expansive frescoes and monumental altarpieces, it was also the age of small-format cabinet paintings on copper. The artists of the Bolognese school excelled in this field, above all Guido Reni and Francesco Albani. The present painting of Christ and the Samaritan Woman (John 4:4–42 ) is an outstanding example of Albani's art, exceptional both for its quality and its provenance: For many years, until the French Revolution, it was owned by the Dukes of Orléans and formed part of one of the most splendid princely art collections in Europe, that of the Palais Royal in Paris.
It was no coincidence that young Bolognese artists such as Reni and Albani in particular popularised painting on copper in Rome in the early Seicento. They learnt in the workshop of the Netherlandish artist Denys Calvaert, who passed on to the young Italians the painting technique that was widespread in his homeland. Painting on copper was characterised by a luminosity that the artists could not achieve on canvas or wooden panels. In Baroque Rome, where princes and cardinals competed for the best works of art for their collections, cabinet paintings on copper (as well as those on stone) became coveted collector's items. A considerable proportion of Albani's early work in Bologna and Rome consisted of such cabinet pictures (Puglisi, op. cit., passim). Puglisi dates the present painting to between 1510 and 1517, when Albani also depicted the biblical theme in a large-format painting (Albani was of course familiar with Annibale Caracci's interpretation) for one of the greatest patrons in Rome, the Marchese Vincenzo Giustiniani (Kunsthistorisches Museum Vienna, inv. no. 2698).
François Albane – Albani and France
The French art historiographer André Félibien writes in his Entretiens (1672): He [Albani] painted pictures of great beauty, and everyone looked at them with pleasure, like those devotional pictures one sees in numerous cabinets in Paris... (‘Il eût fait des Tableaux d'une grande beauté, & que tout le monde eût pû regarder avec plaisir , comme sont ceux de devotion qu'on voit en plusieurs Cabinets de Paris...’). And how the French princes collected Albani's works! The classicism of the Bolognese Baroque perfectly reflected the tastes of the French aristocracy, who were preparing to renew language and the arts in the newly founded academies after Italian principles. For the French, Francesco Albani, like Annibale Caracci, epitomised the classical approach to art of the Bolognese school of painting. As Félibien reports, it was above all the finely painted devotional images such as Christ and the Samaritan woman that appealed to the princely collectors. Malvasia, the best connoisseur and historiographer of the Bolognese school of painting, observed with astonishment that the French in Rome were prepared to pay more for a small cabinet painting by Albani than for a large work by Reni. The greatest collector of Albani's works in France was the king himself: Louis XIV alone owned 21 works, possibly including the young artist's small self-portrait (fig. 1), auctioned by Lempertz, which was painted around the same time as Christ and the Samaritan Woman, was once in the Palace of Versailles and - as one would suspect - was also painted on copper.
Christ and the Samaritan Woman in the Orléans collection
Given the immense esteem in which Albani's work was held in France, it was only natural that the most important princely collection in France after that of the king, the collection of the Dukes of Orléans in the Palais Royal, also possessed a large number of his works. The Orléans collection comprised a total of nine works, including seven cabinet paintings on copper. Christ and the Samaritan Woman is mentioned in the description of the collection of 1727, as well as in the splendid publication of 1786, with an engraving and a description emphasising the exquisite quality of the copper panel in terms of composition, colouring and execution: This painting, wisely conceived, and rendered with ease, is above all remarkable for its excellent colouring (Ce Tableau, sagement pensé, et peint avec facilité, est remarquable sur tout par un excellent coloris; Couché 1786, op. cit.).
During the French Revolution, Albani's small cabinet painting shared the fate of the other masterpieces in the collection. Louis-Philippe II Joseph de Bourbon, Philippe Égalité, sold a considerable part of the collection to an English syndicate, the works were taken to London and successively auctioned off. Numerous masterpieces of Italian art in the newly founded National Gallery in London as well as in aristocratic collections in Great Britain came from the Orléans collection, such as Sebastiano del Piombo's Raising of Lazarus, which is still inventory number one in the National Gallery today. Christ and the Samaritan Woman also travelled to London and changed hands at auction in quick succession before all traces of it were lost. Albani's cabinet painting is thus a testimony to the princely passion for collecting in France, but also to the decline of the Ancien Régime and the emergence of the modern auction market in London in the early 19th century.
Fig. 1: Francesco Albani, Self Portrait, formerly Palace of Versailles, Lempertz, 16.5.2015, lot 1038.
Fig. 2: Jacques Couché: Galerie du Palais royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles etc., Paris 1786.
Öl auf Kupfer. 39 x 29 cm.
Provenienz
Slg. Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, Paris. – Pierre-Louis de Reich de Pennautier, Paris/Versailles, 1711. – Philippe II. de Bourbon, Herzog von Orléans, Palais Royal, Paris. - Louis I. de Bourbon, Herzog von Orléans, Paris. – Durch Erbfolge an Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon, Herzog von Orléans. - Versteigerung Orléans-Sammlung, Auktion Michael Bryan, London, 26.12.1798, Lot 38 (unverkauft). - Auktion Peter Coxe, London, 14.2.1800, Lot 60 (an William Comyns, für 44,2 Pfund). - Slg. William Comyns, London. - Wohl The European Museum, Auktion, London, 25.3.1805. - Slg. Hastings Elwin, London. - Seine Versteigerung, Phillips, London, 6.6.1809, Lot 100. - Galerie Heim-Gairac, c. 1970. - Europäische Privatsammlung.
Literatur
L.-F. Dubois de Saint-Gelais: Description des Tableaux du Palais Royal avec La Vie des Peintres à la tête de leurs Ouvrages., Paris 1727, S. 134. – J. Couché: Galerie du Palais royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles qui la composent : avec un abrégé de la vie des peintres & une description historique de chaque tableau, Bd. 1, Paris 1786, o. S. - W. Buchanan: Memoires of Painting, with a Chronological History of the Importation of Pictures by the Great Masters into England since the French Revolution, London 1824, S. 89. – C. R. Puglisi: Francesco Albani, New Haven/London 1999, S. 131, Nr. 40.LV.a.
Der römische Barock war nicht nur die Epoche der großen Fresken und monumentalen Altargemälde, es war auch das Zeitalter der kleinformatigen Kabinettbilder auf Kupfer. Die Künstler der Bologneser Schule taten sich in diesem Fach besonders hervor, allen voran Guido Reni und Francesco Albani. Ein hervorragendes Beispiel der Kunst Albanis stellt das vorliegende Gemälde Christus und die Samariterin (Johannes, IV, 5-53) dar, außergewöhnlich aufgrund seiner Qualität wie auch seiner Provenienz: Lange Zeit, bis zur Französischen Revolution, befand es sich im Besitz der Herzöge von Orléans und war Bestandteil einer der prachtvollsten fürstlichen Kunstsammlung Europas, jener des Palais Royal in Paris.
Es war kein Zufall, dass vor allem junge Bologneser Künstler wie Reni und Albani die Malerei auf Kupfer im Rom des frühen Seicento populär machten. Sie lernten in der Werkstatt des Niederländers Denys Calvaert, der den jungen Italienern die Maltechnik weitergab, die in seiner Heimat verbreitet war. Die Malerei auf Kupfer zeichnete eine Leuchtkraft aus, die die Künstler auf Leinwänden und Holztafeln nicht erreichten. Im Rom des Barocks, in dem Fürsten und Kardinalnepoten um die besten Kunstwerke für ihre Sammlungen wetteiferten, wurden die Kabinettbilder auf Kupfer (wie auch jene auf Stein) zu begehrten Sammelobjekten. Ein beträchtlicher Anteil des frühen Schaffens von Albani in Bologna und Rom bildeten derartige Kabinettbilder (Puglisi, op. cit., passim). Das vorliegende Gemälde datiert Puglisi zwischen 1510 und 1517, als Albani das biblische Thema auch als großformatiges Gemälde behandelte (Albani kannte selbstverständlich Annibale Caraccis Interpretation), für einen der größten Mäzene in Rom, den Marchese Vincenzo Giustiniani (Kunsthistorisches Museum Wien, Inv.-Nr. 2698).
François Albane – Albani und Frankreich
Der französische Kunsthistoriograph André Félibien schreibt in seinen Entretiens (1672): Er [Albani] malte Gemälde von großer Schönheit, und ein jeder betrachtete sie mit Wohlgefallen, wie jene Andachtsbilder, die man in zahlreichen Kabinetten in Paris sieht… („Il eût fait des Tableaux d’une grande beauté, & que tout le monde eût pû regarder avec plaisir , comme sont ceux de devotion qu’on voit en plusieurs Cabinets de Paris…“). Und wie die französischen Fürsten die Werke Albanis sammelten! Der Klassizismus des Bologneser Barocks entsprach dem Geschmack des französischen Hochadels, der sich anschickte, in den neugegründeten Akademien die Sprache wie die Künste nach italienischem Vorbild zu erneuern. Francesco Albani war für die Franzosen, wie Annibale Caracci, der Inbegriff der klassischen Kunstauffassung der Bologneser Malerschule. Es waren dabei, wie Félibien berichtet, vor allem die fein gemalten Andachtsbilder wie Christus und die Samariterin, die es den fürstlichen Sammlern angetan hatten. Malvasia, der beste Kenner und Historiograph der Bologneser Malerschule, beobachtete mit Erstaunen, dass die Franzosen in Rom bereit waren, für ein kleines Kabinettbild Albanis mehr zu zahlen als für ein großes Werk von Reni. Der größte unter den Sammlern von Werken Albanis in Frankreich war der König höchstselbst: Ludwig XIV. besaß 21 Werke, darunter möglicherweise auch das kleine Selbstportrait des jungen Künstlers (Abb. 1), bei Lempertz versteigert, das etwa zeitgleich mit Christus und die Samariterin entstand, sich einst im Schloss von Versailles befand und – man ahnt es – auf Kupfer gemalt war.
Christus und die Samariterin in der Sammlung Orléans
Angesichts der immensen Wertschätzung des Werks von Albani in Frankreich war es naheliegend, dass die bedeutendste fürstliche Sammlung nach der des Königs, die Sammlung der Herzöge von Orléans im Palais Royal, ebenfalls einen großen Bestand seiner Werke besaß. Sie umfasste insgesamt neun Werke, darunter sieben Kabinettbilder auf Kupfer. Christus und die Samariterin wird in der Beschreibung der Sammlung von 1727 (Abb. 2) erwähnt, ebenso in der prachtvollen Publikation von 1786, mit einem Nachstich und einer Beschreibung, die die exquisite Qualität des Kupferbildes im Hinblick auf Komposition, Kolorit und Ausführung beschreibt: Diese Tafel, klug konzipiert, und mit Leichtigkeit gemalt, ist vor allem bemerkenswert aufgrund seines hervorragenden Kolorits (Ce Tableau, sagement pensé, et peint avec facilité, est remarquable sur tout par un excellent coloris; Couché 1786, op. cit.).
Während der französischen Revolution teilte Albanis kleine Kabinettbild das Schicksal der anderen Meisterwerke der Sammlung Orléans. Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon, Philippe Égalité, veräußerte einen beträchtlichen Teil an ein englisches Syndikat, die Werke wurden nach London verbracht und sukzessive versteigert. Zahlreiche Meisterwerke der italienischen Kunst in der neugegründeten National Gallery in London wie auch in aristokratischen Sammlungen in Großbritannien stammten aus der Sammlung, etwa Sebastiano del Piombos Auferweckung des Lazarus, bis heute die Inventarnummer Eins der National Gallery. Auch Christus und die Samariterin gelangte nach London und wechselte auf Auktionen kurz nacheinander den Besitzer, bevor sich seine Spuren verlieren. So ist Albanis Kabinettbild ein Zeugnis der fürstlichen Sammelleidenschaft in Frankreich, aber auch des Niedergangs des Ancien Régime und der Entstehung des modernen Auktionsmarktes im London des frühen 19. Jahrhunderts.
Abb. 1: Francesco Albani, Selbstportrait, ehemals Schloss von Versailles, Lempertz, 16.5.2015, Lot 1038.
Abb. 2: Jacques Couché: Galerie du Palais Royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles etc., Paris 1786.
Oil on copper. 39 x 29 cm.
Provenance
Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, Paris. - Pierre-Louis de Reich de Pennautier, Paris/Versailles, 1711. - Philippe II de Bourbon, Duke of Orléans, Palais Royal, Paris. - Louis I de Bourbon, Duke of Orléans, Paris. - By succession to Louis-Philippe II Joseph de Bourbon, Duke of Orléans. - Sale of the Orléans Collection, Michael Bryan auction, London, 26 December 1798, lot 38 (unsold). - Auction Peter Coxe, London, 14 February 1800, lot 60 (to William Comyns, for 44.2 pounds). - Coll. William Comyns, London. - Probably The European Museum, auction, London, 25.3.1805. - Coll. Hastings Elwin, London. - His sale, Phillips, London, 6 June 1809, lot 100. - Heim-Gairac Gallery, c. 1970. - European private collection.
Literature
L.-F. Dubois de Saint-Gelais: Description des Tableaux du Palais Royal avec La Vie des Peintres à la tête de leurs Ouvrages, Paris 1727, p. 134. - J. Couché: Galerie du Palais royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles qui la composent : avec un abrégé de la vie des peintres & une description historique de chaque tableau, vol. 1, Paris 1786, n. p. - W. Buchanan: Memoires of Painting, with a Chronological History of the Importation of Pictures by the Great Masters into England since the French Revolution, London 1824, p. 89. - C. R. Puglisi: Francesco Albani, New Haven/London 1999, p. 131, no. 40.LV.a.
The Roman Baroque was not only an era of expansive frescoes and monumental altarpieces, it was also the age of small-format cabinet paintings on copper. The artists of the Bolognese school excelled in this field, above all Guido Reni and Francesco Albani. The present painting of Christ and the Samaritan Woman (John 4:4–42 ) is an outstanding example of Albani's art, exceptional both for its quality and its provenance: For many years, until the French Revolution, it was owned by the Dukes of Orléans and formed part of one of the most splendid princely art collections in Europe, that of the Palais Royal in Paris.
It was no coincidence that young Bolognese artists such as Reni and Albani in particular popularised painting on copper in Rome in the early Seicento. They learnt in the workshop of the Netherlandish artist Denys Calvaert, who passed on to the young Italians the painting technique that was widespread in his homeland. Painting on copper was characterised by a luminosity that the artists could not achieve on canvas or wooden panels. In Baroque Rome, where princes and cardinals competed for the best works of art for their collections, cabinet paintings on copper (as well as those on stone) became coveted collector's items. A considerable proportion of Albani's early work in Bologna and Rome consisted of such cabinet pictures (Puglisi, op. cit., passim). Puglisi dates the present painting to between 1510 and 1517, when Albani also depicted the biblical theme in a large-format painting (Albani was of course familiar with Annibale Caracci's interpretation) for one of the greatest patrons in Rome, the Marchese Vincenzo Giustiniani (Kunsthistorisches Museum Vienna, inv. no. 2698).
François Albane – Albani and France
The French art historiographer André Félibien writes in his Entretiens (1672): He [Albani] painted pictures of great beauty, and everyone looked at them with pleasure, like those devotional pictures one sees in numerous cabinets in Paris... (‘Il eût fait des Tableaux d'une grande beauté, & que tout le monde eût pû regarder avec plaisir , comme sont ceux de devotion qu'on voit en plusieurs Cabinets de Paris...’). And how the French princes collected Albani's works! The classicism of the Bolognese Baroque perfectly reflected the tastes of the French aristocracy, who were preparing to renew language and the arts in the newly founded academies after Italian principles. For the French, Francesco Albani, like Annibale Caracci, epitomised the classical approach to art of the Bolognese school of painting. As Félibien reports, it was above all the finely painted devotional images such as Christ and the Samaritan woman that appealed to the princely collectors. Malvasia, the best connoisseur and historiographer of the Bolognese school of painting, observed with astonishment that the French in Rome were prepared to pay more for a small cabinet painting by Albani than for a large work by Reni. The greatest collector of Albani's works in France was the king himself: Louis XIV alone owned 21 works, possibly including the young artist's small self-portrait (fig. 1), auctioned by Lempertz, which was painted around the same time as Christ and the Samaritan Woman, was once in the Palace of Versailles and - as one would suspect - was also painted on copper.
Christ and the Samaritan Woman in the Orléans collection
Given the immense esteem in which Albani's work was held in France, it was only natural that the most important princely collection in France after that of the king, the collection of the Dukes of Orléans in the Palais Royal, also possessed a large number of his works. The Orléans collection comprised a total of nine works, including seven cabinet paintings on copper. Christ and the Samaritan Woman is mentioned in the description of the collection of 1727, as well as in the splendid publication of 1786, with an engraving and a description emphasising the exquisite quality of the copper panel in terms of composition, colouring and execution: This painting, wisely conceived, and rendered with ease, is above all remarkable for its excellent colouring (Ce Tableau, sagement pensé, et peint avec facilité, est remarquable sur tout par un excellent coloris; Couché 1786, op. cit.).
During the French Revolution, Albani's small cabinet painting shared the fate of the other masterpieces in the collection. Louis-Philippe II Joseph de Bourbon, Philippe Égalité, sold a considerable part of the collection to an English syndicate, the works were taken to London and successively auctioned off. Numerous masterpieces of Italian art in the newly founded National Gallery in London as well as in aristocratic collections in Great Britain came from the Orléans collection, such as Sebastiano del Piombo's Raising of Lazarus, which is still inventory number one in the National Gallery today. Christ and the Samaritan Woman also travelled to London and changed hands at auction in quick succession before all traces of it were lost. Albani's cabinet painting is thus a testimony to the princely passion for collecting in France, but also to the decline of the Ancien Régime and the emergence of the modern auction market in London in the early 19th century.
Fig. 1: Francesco Albani, Self Portrait, formerly Palace of Versailles, Lempertz, 16.5.2015, lot 1038.
Fig. 2: Jacques Couché: Galerie du Palais royal : gravée d'après les tableaux des differentes écoles etc., Paris 1786.
Alte Kunst und 19. Jahrhundert
Auktionsdatum
Ort der Versteigerung
Noch keine Versandinformationen verfügbar.
Shipping information not yet available.
Wichtige Informationen
Zu Aufgeld und Mehrwertsteuer prüfen Sie bitte das jeweilige Los.
For premium and taxes please refer to the particular lot.
AGB
1. Die Kunsthaus Lempertz KG (im Nachfolgenden Lempertz) versteigert öffent- lich im Sinne des § 383 Abs. 3 Satz 1 HGB als Kommissionär für Rechnung der Einlieferer, die unbenannt bleiben. Im Verhältnis zu Abfassungen der Versteige- rungsbedingungen in anderen Sprachen ist die deutsche Fassung maßgeblich.
2. Lempertz behält sich das Recht vor, Nummern des Kataloges zu vereinen, zu trennen und, wenn ein besonderer Grund vorliegt, außerhalb der Reihenfolge anzubieten oder zurückzuziehen.
3. Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Objekte können im Rahmen der Vorbesichtigung geprüft und besichtigt werden. Die Katalogangaben und ent- sprechende Angaben der Internetpräsentation, die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden, werden nicht Bestandteil der vertraglich vereinbar- ten Beschaffenheit. Sie beruhen auf dem zum Zeitpunkt der Katalogbearbeitung herrschenden Stand der Wissenschaft. Sie sind keine Garantien im Rechtssinne und dienen ausschließlich der Information. Gleiches gilt für Zustandsberichte und andere Auskünfte in mündlicher oder schriftlicher Form. Zertifikate oder Bestätigungen der Künstler, ihrer Nachlässe oder der jeweils maßgeblichen Ex- perten sind nur dann Vertragsgegenstand, wenn sie im Katalogtext ausdrücklich erwähnt werden. Der Erhaltungszustand wird im Katalog nicht durchgängig er- wähnt, so dass fehlende Angaben ebenfalls keine Beschaffenheitsvereinbarung begründen. Die Objekte sind gebraucht. Alle Objekte werden in dem Erhaltungs- zustand veräußert, in dem sie sich bei Erteilung des Zuschlages befinden.
4. Ansprüche wegen Gewährleistung sind ausgeschlossen. Lempertz verpflich- tet sich jedoch bei Abweichungen von den Katalogangaben, welche den Wert oder die Tauglichkeit aufheben oder nicht unerheblich mindern, und welche in- nerhalb eines Jahres nach Übergabe in begründeter Weise vorgetragen werden, seine Rechte gegenüber dem Einlieferer gerichtlich geltend zu machen. Maßgeb- lich ist der Katalogtext in deutscher Sprache. Im Falle einer erfolgreichen Inan- spruchnahme des Einlieferers erstattet Lempertz dem Erwerber ausschließlich den gesamten Kaufpreis. Darüber hinaus verpflichtet sich Lempertz für die Dau- er von drei Jahren bei erwiesener Unechtheit zur Rückgabe der Kommission, wenn das Objekt in unverändertem Zustand zurückgegeben wird.
Die gebrauchten Sachen werden in einer öffentlichen Versteigerung verkauft, an der der Bieter/Käufer persönlich teilnehmen kann. Die Regelungen über den Verbrauchsgüterverkauf finden nach § 474 Abs. 1 Satz 2 BGB keine Anwendung.
5. Ansprüche auf Schadensersatz aufgrund eines Mangels, eines Verlustes oder einer Beschädigung des versteigerten Objektes, gleich aus welchem Rechts- grund, oder wegen Abweichungen von Katalogangaben oder anderweitig er- teilten Auskünften und wegen Verletzung von Sorgfaltspflichten nach §§ 41 ff. KGSG sind ausgeschlossen, sofern Lempertz nicht vorsätzlich oder grob fahrläs- sig gehandelt oder vertragswesentliche Pflichten verletzt hat; die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Im Übrigen gilt Ziffer 4.
6. Abgabe von Geboten. Lempertz behält sich die Zulassung zur Auktion vor und kann diese insbesondere von der erfolgreichen Identifizierung im Sinne von § 1 Abs. 3 des GWG abhängig machen. Gebote in Anwesenheit: Der Bieter erhält gegen Vorlage seines Lichtbildausweises eine Bieternummer. Ist der Bieter Lem- pertz nicht bekannt, hat die Anmeldung 24 Stunden vor Beginn der Auktion schriftlich und unter Vorlage einer aktuellen Bankreferenz zu erfolgen. Gebote in Abwesenheit: Gebote können auch schriftlich, telefonisch oder über das Inter- net abgegeben werden. Aufträge für Gebote in Abwesenheit müssen Lempertz zur ordnungsgemäßen Bearbeitung 24 Stunden vor der Auktion vorliegen. Das Objekt ist in dem Auftrag mit seiner Losnummer und der Objektbezeichnung zu benennen. Bei Unklarheiten gilt die angegebene Losnummer. Der Auftrag ist vom Aufraggeber zu unterzeichnen. Die Bestimmungen über Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen (§ 312b-d BGB) finden keine Anwen- dung. Telefongebote: Für das Zustandekommen und die Aufrechterhaltung der Verbindung kann nicht eingestanden werden. Mit Abgabe des Auftrages erklärt sich der Bieter damit einverstanden, dass der Bietvorgang aufgezeichnet werden kann. Gebote über das Internet: Sie werden von Lempertz nur angenommen, wenn der Bieter sich zuvor über das Internetportal registriert hat. Die Gebote werden von Lempertz wie schriftlich abgegebene Gebote behandelt.
7. Durchführung der Auktion: Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebotes kein höheres Gebot abgegeben wird. Der Versteigerer kann sich den Zuschlag vorbehalten oder verweigern, wenn ein besonderer Grund vorliegt, insbesondere wenn der Bieter nicht im Sinne von § 1 Abs. 3 GWG er- folgreich identifiziert werden kann. Wenn mehrere Personen zugleich dasselbe Gebot abgeben und nach dreimaligem Aufruf kein höheres Gebot erfolgt, ent- scheidet das Los. Der Versteigerer kann den erteilten Zuschlag zurücknehmen und die Sache erneut ausbieten, wenn irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot übersehen und dies vom Bieter sofort beanstandet worden ist oder sonst Zweifel über den Zuschlag bestehen. Schriftliche Gebote werden von Lempertz nur in dem Umfang ausgeschöpft, der erforderlich ist, um ein anderes Gebot zu überbieten. Der Versteigerer kann für den Einlieferer bis zum verein- barten Limit bieten, ohne dies anzuzeigen und unabhängig davon, ob andere Ge-
bote abgegeben werden. Wenn trotz abgegebenen Gebots kein Zuschlag erteilt worden ist, haftet der Versteigerer dem Bieter nur bei Vorsatz oder grober Fahr- lässigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.lempertz.com/datenschutzerklärung.html
8. Mit Zuschlag kommt der Vertrag zwischen Versteigerer und Bieter zustande (§ 156 S. 1 BGB). Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Sofern ein Zuschlag un- ter Vorbehalt erteilt wurde, ist der Bieter an sein Gebot bis vier Wochen nach der Auktion gebunden, wenn er nicht unverzüglich nach Erteilung des Zuschlages von dem Vorbehaltszuschlag zurücktritt. Mit der Erteilung des Zuschlages ge- hen Besitz und Gefahr an der versteigerten Sache unmittelbar auf den Bieter/ Ersteigerer über, das Eigentum erst bei vollständigem Zahlungseingang.
9. Auf den Zuschlagspreis wird ein Aufgeld von 26 % zuzüglich 19 % Umsatz- steuer nur auf das Aufgeld erhoben, auf den über € 600.000 hinausgehenden Betrag reduziert sich das Aufgeld auf 20 % (Differenzbesteuerung).
Bei differenzbesteuerten Objekten, die mit N gekennzeichnet sind, wird zusätz- lich die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 7 % berechnet.
Für Katalogpositionen, die mit R gekennzeichnet sind, wird die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 % auf den Zuschlagspreis + Aufgeld berechnet, ab dem 1.1.2025 die gesetzliche Umsatzsteuer von 7% auf Kunstgegenstände und Sammlungsstücke sowie 19% auf alle anderen Objekte (Regelbesteuerung).
Wird ein regelbesteuertes Objekt an eine Person aus einem anderen Mitglieds- staat der EU, die nicht Unternehmer ist, verkauft und geliefert, kommen die um- satzsteuerrechtlichen Vorschriften des Zielstaates zur Anwendung, § 3c UStG. Von der Umsatzsteuer befreit sind Ausfuhrlieferungen in Drittländer (d.h. außerhalb der EU) und – bei Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer – auch an Unternehmen in EU-Mitgliedsstaaten. Für Originalkunstwerke, deren Urheber noch leben oder vor weniger als 70 Jahren (§ 64 UrhG) verstorben sind, wird zur Abgeltung des gemäß § 26 UrhG zu entrichtenden Folgerechts eine Gebühr in Höhe von 1,8 % auf den Hammerpreis erhoben. Bei Zahlungen über einem Betrag von € 10.000,00 ist Lempertz gemäß §3 des GWG verpflichtet, die Kopie eines Lichtbildausweises des Käufers zu erstellen. Dies gilt auch, wenn eine Zahlung für mehrere Rechnungen die Höhe von € 10.000,00 überschreitet. Nehmen Auktionsteilnehmer ersteigerte Objekte selbst in Drittländer mit, wird ihnen die Umsatzsteuer erstattet, sobald Lempertz Ausfuhr- und Abnehmer- nachweis vorliegen. Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum vorbehalten.
10. Ersteigerer haben den Endpreis (Zuschlagspreis zuzüglich Aufgeld + MwSt.) im unmittelbaren Anschluss an die Auktion an Lempertz zu zahlen. Zahlungen sind in Euro zu tätigen. Eine Zahlung mit Kryptowährungen ist möglich. Die Rechnung wird per E-Mail übermittelt, es sei denn, der Ersteigerer äußert den Wunsch, diese per Post zu erhalten. Der Antrag auf Änderung oder Umschrei- bung einer Rechnung, z.B. auf einen anderen Kunden als den Bieter, muss unmit- telbar im Anschluss an die Auktion abgegeben werden. Durch die Änderung kön- nen zusätzliche Gebühren anfallen. Die Umschreibung erfolgt unter Vorbehalt der erfolgreichen Identifizierung (§ 1 Abs. 3 GWG) des Bieters und derjenigen Person, auf die die Umschreibung der Rechnung erfolgt. Rechnungen werden nur an diejenigen Personen ausgestellt, die die Rechnung tatsächlich begleichen.
11. Bei Zahlungsverzug werden 1 % Zinsen auf den Bruttopreis pro Monat be- rechnet. Lempertz kann bei Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung des Kaufver- trages oder nach Fristsetzung Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle auch so berechnet werden, dass die Sache nochmals versteigert wird und der säumige Ersteigerer für einen Mindererlös gegenüber der vorangegangenen Versteigerung und für die Kosten der wieder- holten Versteigerung einschließlich des Aufgeldes einzustehen hat.
12. Die Ersteigerer sind verpflichtet, ihre Erwerbung sofort nach der Auktion in Empfang zu nehmen. Lempertz haftet für versteigerte Objekte nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Ersteigerte Objekte werden erst nach vollständigem Zahlungseingang ausgeliefert. Eine Versendung erfolgt ausnahmslos auf Kosten und Gefahr des Ersteigerers. Lempertz ist berechtigt, nicht abgeholte Objekte vier Wochen nach der Auktion im Namen und auf Rechnung des Ersteigerers bei einem Spediteur einlagern und versichern zu lassen. Bei einer Selbsteinlagerung durch Lempertz werden 1 % p.a. des Zuschlagspreises für Versicherungs- und Lagerkosten berechnet.
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand, sofern er vereinbart werden kann, ist Köln. Es gilt deutsches Recht; Das Kulturgutschutzgesetz wird angewandt. Das UN-Übereinkommen über Verträge des internationalen Warenkaufs (CISG) fin- det keine Anwendung. Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise un- wirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen davon unberührt. Es wird auf die Datenschutzerklärung auf unserer Webpräsenz hingewiesen.