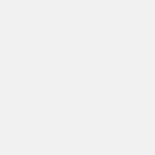400
Otto Greiner – Werke aus einer sächsischen Privatsammlung
Otto Greiner – Werke aus einer sächsischen Privatsammlung
Otto Greiner 1869 Leipzig – 1916 München
Max Klinger 1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Werner Teupser 1895 Leipzig – 1954 München
(Das ist kein Auktionsartikel. Bitte nicht bieten).
Die vorliegende Sammlung offenbart in Otto Greiner einmal mehr einen exzellenten Zeichner und Grafiker mit faszinierender Bildwelt und bewegter Biografie. Er erlebte die Jahrhundertwende um 1900 in seiner Geburtsstadt Leipzig, seinem Studienort München und seiner Wahlheimat Rom. Sein künstlerisches Schaffen hatte sein Fundament in einer lithografischen Ausbildung und wurde maßgeblich durch die Strömung des Symbolismus geprägt. Ganz im Sinne des Zeitgeistes schuf Greiner Monumentalgemälde, von denen nur wenige erhalten sind. Nach Erwerb im internationalen Auktionshandel kann die Staatsgalerie Stuttgart seit 2011 das Gemälde "Herkules bei Omphale" (1905) präsentieren. Greiners wohl eindrucksvollstes malerisches Werk hingegen, das in Rom entstandene und vom Museum der bildenden Künste in Leipzig erworbene Monumentalbild "Odysseus und die Sirenen" (1902), ging nach Auslagerung im Zweiten Weltkrieg verloren.
Umso glücklicher ist der Umstand, dass ein großer Teil seines grafischen Oeuvres erhalten blieb, nicht zuletzt durch die Verwaltung eines Teils des Greiner'schen Nachlasses durch den Leipziger Kunstverein sowie die Witwe des Künstlers Nannina Greiner in Rom.
Neben Lithografien von Greiners Hauptmotiven enthält die Offerte auch unikale Zeichnungen und Studien, die der Künstler in Vorarbeit seiner komplexen Kompositionen anfertigte und eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sujet widerspiegeln.
Zentral für Greiners Werk ist die Stilisierung und Idealisierung des nackten, menschlichen Körpers. Detailliert beschäftigte er sich mit dessen Anatomie und Dynamik. Neben den Aktdarstellungen verdienen auch Greiners Porträts Beachtung, ebenso die Darstellungen der südlichen Landschaft, die ihn während seinen Jahren in Rom umgab.
Otto Greiner verarbeitete seine Eindrücke zu bildgewaltigen, allegorischen, religiösen und mythologischen Werken, wobei sich der Geschlechterkonflikt wie ein roter Faden durch sein Œuvre zieht. In unheilvoller, teils expliziter Erotik zeigt er die Frau oft als sündige Verführerin des Mannes. Deutlich wird dies insbesondere in Greiners einzigem Grafikzyklus "Vom Weibe" (1898–1900). Einige Motive dieser eindrucksvollen, aus fünf Blättern bestehenden Werkfolge finden sich in der vorliegenden Sammlung, darunter einzigartige Vorzeichnungen für die Lithografien "Der Teufel zeigt das Weib dem Volke" (1898) und "Golgatha" (1900). Das Kreuzigungsthema stellte Greiner in den Jahren um 1900 mehrfach in verschiedenen Kompositionen dar.
Stilistisch sind Parallelen zum Werk Max Klingers offensichtlich. Das im Museum der bildenden Künste ausgestellte Gemälde "Die Kreuzigung Christi" (1890), ein Hauptwerk Klingers, zeigt die thematisch große Überschneidung der beiden aus Leipzig stammenden Symbolisten. Nachdem sich Klinger und Greiner zu Beginn der 1890er Jahre in Rom begegnet waren, verband sie eine lebenslange Freundschaft. Die Tatsache, dass Greiner seinen Zyklus "Vom Weibe" Klinger widmete, zeugt von einer großen Wertschätzung des künstlerischen Schaffens seines Freundes. Eine Lehrer-Schüler-Beziehung wurde jedoch trotz der engen persönlichen Verbundenheit stets dementiert (Vgl. Julius Vogel, 1925, S. 39).
In der kunsthistorischen Wahrnehmung wurde Otto Greiner oft von Max Klinger überstrahlt, doch "[seine] große[n] Zeichnungen der späteren Jahre gehören zu den besten künstlerischen Leistungen und verdienen sogar vor denen Klingers den Vorzug" (zitiert nach Rolf Günther, 2005. S. 60).
Lit.:
Richard Hüttel, Bodo Pientka: Wahlverwandtschaften – Künstler um Max Klinger: Sammlung Bodo Pientka: Begleitbuch zur Ausstellung vom 3. Oktober bis 22. November 2020, Galerie im Schlösschen Naumburg (Saale). Naumburg 2020.
Rolf Günther: Traumdunkel. Der Symbolismus in Sachsen 1870 – 1920. Dresden 2005.
Birgit Götting: Otto Greiner: 1869 – 1916; die Entstehung eines Künstlers: zu den Aufstiegsbedingungen eines begabten Handwerkslithographen zu anerkannter Künstlergröße. 1980.
Secession – Europäische Kunst um die Jahrhundertwende. Ausstellungskatalog, Haus der Kunst München, 14. März bis 10. Mai 1964. München 1964.
Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg. 7 Nr. 6 (1954). S. 170f.
Julius Vogel: Otto Greiner. Bielefeld / Leipzig 1925.
Leipziger Kunstverein (Hrsg.): Ausstellung zum Gedächtnis von Otto Greiner, gest. 24. September 1916. Leipzig 1917.
Julius Vogel: Otto Greiners graphische Arbeiten in Lithographie, Stich und Radierung. Dresden 1917.
Hans Singer: Otto Greiner – Meister der Zeichnung. Band 4, Leipzig 1912.
Julius Vogel: Otto Greiner. Leipzig 1903.
Maße:
Otto Greiner
1869 Leipzig – 1916 München
Lithografenlehre im Verlag Julius Klinkhardt in Leipzig, erster Zeichenunterricht bei Arthur Haferkorn. 1888–91 Studium an der Kunstakademie München in der Malklasse von Alexander Liezen-Mayer. 1891 Reise nach Italien, wo er in Rom Max Klinger kennenlernte, mit welchem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Nach kürzeren Aufenthalten in Leipzig und München zog Greiner 1898 nach Rom und übernahm Klingers Atelier unweit des Kolosseums. In der italienischen Wahlheimat entstand ein Großteil seines künstlerischen Werks, hauptsächlich grafische Arbeiten. Heirat mit Nannina Duranti. 1915 Kriegseintritt Italiens, Flucht nach München. Auftrag für zwei Wandgemälde im Lesesaal der Deutschen Bücherei in Leipzig, die er jedoch krankheitsbedingt nie fertigstellen konnte. Starb 1916 an den Folgen einer Lungenentzündung.
Max Klinger
1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Geboren als zweiter Sohn eines Seifensieders studierte er zunächst (nach versch. Empfehlungen) an der Großherzoglich Badischen Kunstschule in Karlsruhe. 1875 Fortsetzung der Ausbildung an der Berliner Akademie der Künste nach dem Vorbild Adolph Menzels. 1881 siedelte er nach Berlin über, wo er sein eigenes Atelier unterhielt. Mehrfach längere Aufenthalte in Brüssel, München, Paris und Rom. Klinger hatte bereits sehr früh großen Erfolg als Grafiker, u.a. mit dem Radierzyklus "Paraphrase über den Fund eines Handschuhs" (1881). Mit seinen Arbeiten "Beethoven", "Die neue Salome" und "Kassandra" gilt er als einer der wichtigsten Vertreter polychromer Plastik um 1900. Seine eigenwillige symbolische Bildsprache, besonders in den grafischen Arbeiten, machte ihn zu einem frühen Vorläufer des Surrealismus.
Werner Teupser
1895 Leipzig – 1954 München
Studium der Kunstgeschichte an der Universität Leipzig bei August Schmarsow, Rudolf Wackernagel, Adolf Goldschmidt und Wilhelm Pinder.1921 Promotion zum Thema "Die deutschrömische Landschaft vom Ende des 18. Jahrhunderts". Seinem Forschungsgebiet sollte Teupser zeitlebens treu bleiben, nachdem er bereits früh archäologische Studien in Italien betrieben hatte. 1923 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum der bildenden Künste sowie künstlerischer Leiter und Bibliothekar des Leipziger Kunstvereins. 1929 Kustos und bald darauf Direktor des Museums. 1939 Geschäftsführer des Kunstvereins. Nachdem er 1945 aus allen Ämtern ausscheiden musste, war Teupser als freier Kunstschriftsteller tätig und verfasste u.a. Beiträge für die "Neue Deutsche Biografie". 1946 Cheflektor und Redakteur des Kunstverlags E. A. Seemann, der bis 1951 die "Zeitschrift für Kunst" herausgab. Umzug nach München zur Redaktion der Neuauflage des "Allgemeinen Lexikons der bildenden Künstler" von Thieme-Becker.
Otto Greiner – Werke aus einer sächsischen Privatsammlung
Otto Greiner 1869 Leipzig – 1916 München
Max Klinger 1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Werner Teupser 1895 Leipzig – 1954 München
Die vorliegende Sammlung offenbart in Otto Greiner einmal mehr einen exzellenten Zeichner und Grafiker mit faszinierender Bildwelt und bewegter Biografie. Er erlebte die Jahrhundertwende um 1900 in seiner Geburtsstadt Leipzig, seinem Studienort München und seiner Wahlheimat Rom. Sein künstlerisches Schaffen hatte sein Fundament in einer lithografischen Ausbildung und wurde maßgeblich durch die Strömung des Symbolismus geprägt. Ganz im Sinne des Zeitgeistes schuf Greiner Monumentalgemälde, von denen nur wenige erhalten sind. Nach Erwerb im internationalen Auktionshandel kann die Staatsgalerie Stuttgart seit 2011 das Gemälde "Herkules bei Omphale" (1905) präsentieren. Greiners wohl eindrucksvollstes malerisches Werk hingegen, das in Rom entstandene und vom Museum der bildenden Künste in Leipzig erworbene Monumentalbild "Odysseus und die Sirenen" (1902), ging nach Auslagerung im Zweiten Weltkrieg verloren.
Umso glücklicher ist der Umstand, dass ein großer Teil seines grafischen Oeuvres erhalten blieb, nicht zuletzt durch die Verwaltung eines Teils des Greiner'schen Nachlasses durch den Leipziger Kunstverein sowie die Witwe des Künstlers Nannina Greiner in Rom.
Neben Lithografien von Greiners Hauptmotiven enthält die Offerte auch unikale Zeichnungen und Studien, die der Künstler in Vorarbeit seiner komplexen Kompositionen anfertigte und eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sujet widerspiegeln.
Zentral für Greiners Werk ist die Stilisierung und Idealisierung des nackten, menschlichen Körpers. Detailliert beschäftigte er sich mit dessen Anatomie und Dynamik. Neben den Aktdarstellungen verdienen auch Greiners Porträts Beachtung, ebenso die Darstellungen der südlichen Landschaft, die ihn während seinen Jahren in Rom umgab.
Otto Greiner verarbeitete seine Eindrücke zu bildgewaltigen, allegorischen, religiösen und mythologischen Werken, wobei sich der Geschlechterkonflikt wie ein roter Faden durch sein Œuvre zieht. In unheilvoller, teils expliziter Erotik zeigt er die Frau oft als sündige Verführerin des Mannes. Deutlich wird dies insbesondere in Greiners einzigem Grafikzyklus "Vom Weibe" (1898–1900). Einige Motive dieser eindrucksvollen, aus fünf Blättern bestehenden Werkfolge finden sich in der vorliegenden Sammlung, darunter einzigartige Vorzeichnungen für die Lithografien "Der Teufel zeigt das Weib dem Volke" (1898) und "Golgatha" (1900). Das Kreuzigungsthema stellte Greiner in den Jahren um 1900 mehrfach in verschiedenen Kompositionen dar.
Stilistisch sind Parallelen zum Werk Max Klingers offensichtlich. Das im Museum der bildenden Künste ausgestellte Gemälde "Die Kreuzigung Christi" (1890), ein Hauptwerk Klingers, zeigt die thematisch große Überschneidung der beiden aus Leipzig stammenden Symbolisten. Nachdem sich Klinger und Greiner zu Beginn der 1890er Jahre in Rom begegnet waren, verband sie eine lebenslange Freundschaft. Die Tatsache, dass Greiner seinen Zyklus "Vom Weibe" Klinger widmete, zeugt von einer großen Wertschätzung des künstlerischen Schaffens seines Freundes. Eine Lehrer-Schüler-Beziehung wurde jedoch trotz der engen persönlichen Verbundenheit stets dementiert (Vgl. Julius Vogel, 1925, S. 39).
In der kunsthistorischen Wahrnehmung wurde Otto Greiner oft von Max Klinger überstrahlt, doch "[seine] große[n] Zeichnungen der späteren Jahre gehören zu den besten künstlerischen Leistungen und verdienen sogar vor denen Klingers den Vorzug" (zitiert nach Rolf Günther, 2005. S. 60).
Lit.:
Richard Hüttel, Bodo Pientka: Wahlverwandtschaften – Künstler um Max Klinger: Sammlung Bodo Pientka: Begleitbuch zur Ausstellung vom 3. Oktober bis 22. November 2020, Galerie im Schlösschen Naumburg (Saale). Naumburg 2020.
Rolf Günther: Traumdunkel. Der Symbolismus in Sachsen 1870 – 1920. Dresden 2005.
Birgit Götting: Otto Greiner: 1869 – 1916; die Entstehung eines Künstlers: zu den Aufstiegsbedingungen eines begabten Handwerkslithographen zu anerkannter Künstlergröße. 1980.
Secession – Europäische Kunst um die Jahrhundertwende. Ausstellungskatalog, Haus der Kunst München, 14. März bis 10. Mai 1964. München 1964.
Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg. 7 Nr. 6 (1954). S. 170f.
Julius Vogel: Otto Greiner. Bielefeld / Leipzig 1925.
Leipziger Kunstverein (Hrsg.): Ausstellung zum Gedächtnis von Otto Greiner, gest. 24. September 1916. Leipzig 1917.
Julius Vogel: Otto Greiners graphische Arbeiten in Lithographie, Stich und Radierung. Dresden 1917.
Hans Singer: Otto Greiner – Meister der Zeichnung. Band 4, Leipzig 1912.
Julius Vogel: Otto Greiner. Leipzig 1903.
Maße:
Otto Greiner – Werke aus einer sächsischen Privatsammlung
Otto Greiner 1869 Leipzig – 1916 München
Max Klinger 1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Werner Teupser 1895 Leipzig – 1954 München
(Das ist kein Auktionsartikel. Bitte nicht bieten).
Die vorliegende Sammlung offenbart in Otto Greiner einmal mehr einen exzellenten Zeichner und Grafiker mit faszinierender Bildwelt und bewegter Biografie. Er erlebte die Jahrhundertwende um 1900 in seiner Geburtsstadt Leipzig, seinem Studienort München und seiner Wahlheimat Rom. Sein künstlerisches Schaffen hatte sein Fundament in einer lithografischen Ausbildung und wurde maßgeblich durch die Strömung des Symbolismus geprägt. Ganz im Sinne des Zeitgeistes schuf Greiner Monumentalgemälde, von denen nur wenige erhalten sind. Nach Erwerb im internationalen Auktionshandel kann die Staatsgalerie Stuttgart seit 2011 das Gemälde "Herkules bei Omphale" (1905) präsentieren. Greiners wohl eindrucksvollstes malerisches Werk hingegen, das in Rom entstandene und vom Museum der bildenden Künste in Leipzig erworbene Monumentalbild "Odysseus und die Sirenen" (1902), ging nach Auslagerung im Zweiten Weltkrieg verloren.
Umso glücklicher ist der Umstand, dass ein großer Teil seines grafischen Oeuvres erhalten blieb, nicht zuletzt durch die Verwaltung eines Teils des Greiner'schen Nachlasses durch den Leipziger Kunstverein sowie die Witwe des Künstlers Nannina Greiner in Rom.
Neben Lithografien von Greiners Hauptmotiven enthält die Offerte auch unikale Zeichnungen und Studien, die der Künstler in Vorarbeit seiner komplexen Kompositionen anfertigte und eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sujet widerspiegeln.
Zentral für Greiners Werk ist die Stilisierung und Idealisierung des nackten, menschlichen Körpers. Detailliert beschäftigte er sich mit dessen Anatomie und Dynamik. Neben den Aktdarstellungen verdienen auch Greiners Porträts Beachtung, ebenso die Darstellungen der südlichen Landschaft, die ihn während seinen Jahren in Rom umgab.
Otto Greiner verarbeitete seine Eindrücke zu bildgewaltigen, allegorischen, religiösen und mythologischen Werken, wobei sich der Geschlechterkonflikt wie ein roter Faden durch sein Œuvre zieht. In unheilvoller, teils expliziter Erotik zeigt er die Frau oft als sündige Verführerin des Mannes. Deutlich wird dies insbesondere in Greiners einzigem Grafikzyklus "Vom Weibe" (1898–1900). Einige Motive dieser eindrucksvollen, aus fünf Blättern bestehenden Werkfolge finden sich in der vorliegenden Sammlung, darunter einzigartige Vorzeichnungen für die Lithografien "Der Teufel zeigt das Weib dem Volke" (1898) und "Golgatha" (1900). Das Kreuzigungsthema stellte Greiner in den Jahren um 1900 mehrfach in verschiedenen Kompositionen dar.
Stilistisch sind Parallelen zum Werk Max Klingers offensichtlich. Das im Museum der bildenden Künste ausgestellte Gemälde "Die Kreuzigung Christi" (1890), ein Hauptwerk Klingers, zeigt die thematisch große Überschneidung der beiden aus Leipzig stammenden Symbolisten. Nachdem sich Klinger und Greiner zu Beginn der 1890er Jahre in Rom begegnet waren, verband sie eine lebenslange Freundschaft. Die Tatsache, dass Greiner seinen Zyklus "Vom Weibe" Klinger widmete, zeugt von einer großen Wertschätzung des künstlerischen Schaffens seines Freundes. Eine Lehrer-Schüler-Beziehung wurde jedoch trotz der engen persönlichen Verbundenheit stets dementiert (Vgl. Julius Vogel, 1925, S. 39).
In der kunsthistorischen Wahrnehmung wurde Otto Greiner oft von Max Klinger überstrahlt, doch "[seine] große[n] Zeichnungen der späteren Jahre gehören zu den besten künstlerischen Leistungen und verdienen sogar vor denen Klingers den Vorzug" (zitiert nach Rolf Günther, 2005. S. 60).
Lit.:
Richard Hüttel, Bodo Pientka: Wahlverwandtschaften – Künstler um Max Klinger: Sammlung Bodo Pientka: Begleitbuch zur Ausstellung vom 3. Oktober bis 22. November 2020, Galerie im Schlösschen Naumburg (Saale). Naumburg 2020.
Rolf Günther: Traumdunkel. Der Symbolismus in Sachsen 1870 – 1920. Dresden 2005.
Birgit Götting: Otto Greiner: 1869 – 1916; die Entstehung eines Künstlers: zu den Aufstiegsbedingungen eines begabten Handwerkslithographen zu anerkannter Künstlergröße. 1980.
Secession – Europäische Kunst um die Jahrhundertwende. Ausstellungskatalog, Haus der Kunst München, 14. März bis 10. Mai 1964. München 1964.
Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg. 7 Nr. 6 (1954). S. 170f.
Julius Vogel: Otto Greiner. Bielefeld / Leipzig 1925.
Leipziger Kunstverein (Hrsg.): Ausstellung zum Gedächtnis von Otto Greiner, gest. 24. September 1916. Leipzig 1917.
Julius Vogel: Otto Greiners graphische Arbeiten in Lithographie, Stich und Radierung. Dresden 1917.
Hans Singer: Otto Greiner – Meister der Zeichnung. Band 4, Leipzig 1912.
Julius Vogel: Otto Greiner. Leipzig 1903.
Maße:
Otto Greiner
1869 Leipzig – 1916 München
Lithografenlehre im Verlag Julius Klinkhardt in Leipzig, erster Zeichenunterricht bei Arthur Haferkorn. 1888–91 Studium an der Kunstakademie München in der Malklasse von Alexander Liezen-Mayer. 1891 Reise nach Italien, wo er in Rom Max Klinger kennenlernte, mit welchem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Nach kürzeren Aufenthalten in Leipzig und München zog Greiner 1898 nach Rom und übernahm Klingers Atelier unweit des Kolosseums. In der italienischen Wahlheimat entstand ein Großteil seines künstlerischen Werks, hauptsächlich grafische Arbeiten. Heirat mit Nannina Duranti. 1915 Kriegseintritt Italiens, Flucht nach München. Auftrag für zwei Wandgemälde im Lesesaal der Deutschen Bücherei in Leipzig, die er jedoch krankheitsbedingt nie fertigstellen konnte. Starb 1916 an den Folgen einer Lungenentzündung.
Max Klinger
1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Geboren als zweiter Sohn eines Seifensieders studierte er zunächst (nach versch. Empfehlungen) an der Großherzoglich Badischen Kunstschule in Karlsruhe. 1875 Fortsetzung der Ausbildung an der Berliner Akademie der Künste nach dem Vorbild Adolph Menzels. 1881 siedelte er nach Berlin über, wo er sein eigenes Atelier unterhielt. Mehrfach längere Aufenthalte in Brüssel, München, Paris und Rom. Klinger hatte bereits sehr früh großen Erfolg als Grafiker, u.a. mit dem Radierzyklus "Paraphrase über den Fund eines Handschuhs" (1881). Mit seinen Arbeiten "Beethoven", "Die neue Salome" und "Kassandra" gilt er als einer der wichtigsten Vertreter polychromer Plastik um 1900. Seine eigenwillige symbolische Bildsprache, besonders in den grafischen Arbeiten, machte ihn zu einem frühen Vorläufer des Surrealismus.
Werner Teupser
1895 Leipzig – 1954 München
Studium der Kunstgeschichte an der Universität Leipzig bei August Schmarsow, Rudolf Wackernagel, Adolf Goldschmidt und Wilhelm Pinder.1921 Promotion zum Thema "Die deutschrömische Landschaft vom Ende des 18. Jahrhunderts". Seinem Forschungsgebiet sollte Teupser zeitlebens treu bleiben, nachdem er bereits früh archäologische Studien in Italien betrieben hatte. 1923 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum der bildenden Künste sowie künstlerischer Leiter und Bibliothekar des Leipziger Kunstvereins. 1929 Kustos und bald darauf Direktor des Museums. 1939 Geschäftsführer des Kunstvereins. Nachdem er 1945 aus allen Ämtern ausscheiden musste, war Teupser als freier Kunstschriftsteller tätig und verfasste u.a. Beiträge für die "Neue Deutsche Biografie". 1946 Cheflektor und Redakteur des Kunstverlags E. A. Seemann, der bis 1951 die "Zeitschrift für Kunst" herausgab. Umzug nach München zur Redaktion der Neuauflage des "Allgemeinen Lexikons der bildenden Künstler" von Thieme-Becker.
Otto Greiner – Werke aus einer sächsischen Privatsammlung
Otto Greiner 1869 Leipzig – 1916 München
Max Klinger 1857 Leipzig – 1920 Groß-Jena/Naumburg
Werner Teupser 1895 Leipzig – 1954 München
Die vorliegende Sammlung offenbart in Otto Greiner einmal mehr einen exzellenten Zeichner und Grafiker mit faszinierender Bildwelt und bewegter Biografie. Er erlebte die Jahrhundertwende um 1900 in seiner Geburtsstadt Leipzig, seinem Studienort München und seiner Wahlheimat Rom. Sein künstlerisches Schaffen hatte sein Fundament in einer lithografischen Ausbildung und wurde maßgeblich durch die Strömung des Symbolismus geprägt. Ganz im Sinne des Zeitgeistes schuf Greiner Monumentalgemälde, von denen nur wenige erhalten sind. Nach Erwerb im internationalen Auktionshandel kann die Staatsgalerie Stuttgart seit 2011 das Gemälde "Herkules bei Omphale" (1905) präsentieren. Greiners wohl eindrucksvollstes malerisches Werk hingegen, das in Rom entstandene und vom Museum der bildenden Künste in Leipzig erworbene Monumentalbild "Odysseus und die Sirenen" (1902), ging nach Auslagerung im Zweiten Weltkrieg verloren.
Umso glücklicher ist der Umstand, dass ein großer Teil seines grafischen Oeuvres erhalten blieb, nicht zuletzt durch die Verwaltung eines Teils des Greiner'schen Nachlasses durch den Leipziger Kunstverein sowie die Witwe des Künstlers Nannina Greiner in Rom.
Neben Lithografien von Greiners Hauptmotiven enthält die Offerte auch unikale Zeichnungen und Studien, die der Künstler in Vorarbeit seiner komplexen Kompositionen anfertigte und eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Sujet widerspiegeln.
Zentral für Greiners Werk ist die Stilisierung und Idealisierung des nackten, menschlichen Körpers. Detailliert beschäftigte er sich mit dessen Anatomie und Dynamik. Neben den Aktdarstellungen verdienen auch Greiners Porträts Beachtung, ebenso die Darstellungen der südlichen Landschaft, die ihn während seinen Jahren in Rom umgab.
Otto Greiner verarbeitete seine Eindrücke zu bildgewaltigen, allegorischen, religiösen und mythologischen Werken, wobei sich der Geschlechterkonflikt wie ein roter Faden durch sein Œuvre zieht. In unheilvoller, teils expliziter Erotik zeigt er die Frau oft als sündige Verführerin des Mannes. Deutlich wird dies insbesondere in Greiners einzigem Grafikzyklus "Vom Weibe" (1898–1900). Einige Motive dieser eindrucksvollen, aus fünf Blättern bestehenden Werkfolge finden sich in der vorliegenden Sammlung, darunter einzigartige Vorzeichnungen für die Lithografien "Der Teufel zeigt das Weib dem Volke" (1898) und "Golgatha" (1900). Das Kreuzigungsthema stellte Greiner in den Jahren um 1900 mehrfach in verschiedenen Kompositionen dar.
Stilistisch sind Parallelen zum Werk Max Klingers offensichtlich. Das im Museum der bildenden Künste ausgestellte Gemälde "Die Kreuzigung Christi" (1890), ein Hauptwerk Klingers, zeigt die thematisch große Überschneidung der beiden aus Leipzig stammenden Symbolisten. Nachdem sich Klinger und Greiner zu Beginn der 1890er Jahre in Rom begegnet waren, verband sie eine lebenslange Freundschaft. Die Tatsache, dass Greiner seinen Zyklus "Vom Weibe" Klinger widmete, zeugt von einer großen Wertschätzung des künstlerischen Schaffens seines Freundes. Eine Lehrer-Schüler-Beziehung wurde jedoch trotz der engen persönlichen Verbundenheit stets dementiert (Vgl. Julius Vogel, 1925, S. 39).
In der kunsthistorischen Wahrnehmung wurde Otto Greiner oft von Max Klinger überstrahlt, doch "[seine] große[n] Zeichnungen der späteren Jahre gehören zu den besten künstlerischen Leistungen und verdienen sogar vor denen Klingers den Vorzug" (zitiert nach Rolf Günther, 2005. S. 60).
Lit.:
Richard Hüttel, Bodo Pientka: Wahlverwandtschaften – Künstler um Max Klinger: Sammlung Bodo Pientka: Begleitbuch zur Ausstellung vom 3. Oktober bis 22. November 2020, Galerie im Schlösschen Naumburg (Saale). Naumburg 2020.
Rolf Günther: Traumdunkel. Der Symbolismus in Sachsen 1870 – 1920. Dresden 2005.
Birgit Götting: Otto Greiner: 1869 – 1916; die Entstehung eines Künstlers: zu den Aufstiegsbedingungen eines begabten Handwerkslithographen zu anerkannter Künstlergröße. 1980.
Secession – Europäische Kunst um die Jahrhundertwende. Ausstellungskatalog, Haus der Kunst München, 14. März bis 10. Mai 1964. München 1964.
Kunstchronik. Monatsschrift für Kunstwissenschaft, Museumswesen und Denkmalpflege, Jg. 7 Nr. 6 (1954). S. 170f.
Julius Vogel: Otto Greiner. Bielefeld / Leipzig 1925.
Leipziger Kunstverein (Hrsg.): Ausstellung zum Gedächtnis von Otto Greiner, gest. 24. September 1916. Leipzig 1917.
Julius Vogel: Otto Greiners graphische Arbeiten in Lithographie, Stich und Radierung. Dresden 1917.
Hans Singer: Otto Greiner – Meister der Zeichnung. Band 4, Leipzig 1912.
Julius Vogel: Otto Greiner. Leipzig 1903.
Maße:
81. Kunstauktion
Auktionsdatum
Ort der Versteigerung
Gern versenden wir national und international.
We will be happy to ship worldwide.
Wichtige Informationen
Werke einer Dresdner Privatsammlung
Gemälde, Arbeiten auf Papier &
Druckgrafik des 16. – 21. Jh.
Antiquitäten & Kunsthandwerk
Zu Aufgeld und Mehrwertsteuer prüfen Sie bitte das jeweilige Los.
For premium and taxes please refer to the particular lot.
AGB
Versteigerungsbedingungen der Firma
Schmidt Kunstauktionen Dresden OHG
1. Geltung
Die nachfolgenden Bedingungen werden mit Teilnahme an der Auktion oder dem Nach- und Freihandverkauf, insbesondere durch Abgabe eines Gebotes, anerkannt. Die Bedingungen gelten sinngemäß für den Nachverkauf.
2. Versteigerung in Kommission, Vorbesichtigung
2.1 Die Firma Schmidt Kunstauktionen Dresden OHG (im folgenden Auktionshaus genannt) führt die Versteigerung und den Nach- und Freihandverkauf in der Regel als Kommissionär im eigenen Namen sowie auf freiwilligen Auftrag und für Rechnung des Auftraggebers durch. Ein Anspruch auf Bekanntgabe des Auftraggebers besteht nicht.
2.2 Alle zur Versteigerung kommenden Gegenstände können während der angegebenen Vorbesichtigungszeiten vor der Auktion besichtigt und geprüft werden.
3. Schätzpreise, Beschaffenheit, Gewährleistung
3.1 Die im Katalog angegebenen Preise sind unverbindliche Schätzpreise und sollen dem Käufer lediglich als Richtlinie eines ungefähren Marktwertes des angebotenen Objektes dienen.
3.2 Die zur Versteigerung gelangenden Objekte sind ausnahmslos gebraucht und werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich befinden. In allen Fällen ist der tatsächliche Erhaltungszustand des Objektes zum Zeitpunkt des Zuschlages vereinbarte Beschaffenheit. Das Auktionshaus haftet nicht für offene oder versteckte Mängel, für schriftliche oder mündliche Beschreibungen, Schätzpreise oder Abbildungen zu Objekten. Diese dienen nur zur Information des Bieters und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Garantien dar. Mängel werden im Katalog nur erwähnt, wenn sie nach Auffassung des Auktionshauses den optischen Gesamteindruck oder den Wert des Objektes maßgeblich beeinträchtigen.
Insofern Beschreibungen in gedruckten Katalogen nur verkürzt wiedergegeben werden, so gelten diese nur in Verbindung mit den Beschreibungen im Online-Katalog.
3.3 Das Auktionshaus haftet nicht für die Gebrauchsfähigkeit oder Betriebssicherheit von Objekten oder deren Übereinstimmung mit geltenden Normen.
3.4 Alle Ansprüche des Käufers richten sich gegen den Auftraggeber des Auktionshauses. Das Auktionshaus verpflichtet sich, berechtigte Mängelbeanstandungen innerhalb der gesetzlichen Fristen an den Einlieferer weiterzuleiten. Mängelansprüche des Käufers verjähren nach 12 Monaten.
3.5 Das Auktionshaus behält sich vor, Angaben über die zu versteigernden Objekte zu berichtigen. Diese Berichtigung erfolgt durch schriftlichen Aushang am Ort der Versteigerung und mündlich durch den Auktionator unmittelbar vor der Versteigerung des einzelnen Objektes. Die berichtigten Angaben treten an die Stelle vorangegangener Beschreibungen.
4. Bieter, Bieternummern
4.1 Dem Auktionshaus unbekannte Bieter werden gebeten, sich unter Vorlage ihres Personalausweises zu legitimieren und gegebenenfalls eine aktuelle Bonitätsbescheinigung ihrer Bank oder ein Bar-Depot zu hinterlegen.
4.2 Alle Gebote gelten als vom Bieter im eigenen Namen und für eigene Rechnung abgegeben, der Bieter ist persönlich haftbar und haftet auch für die mißbräuchliche Benutzung seiner Bieternummer.
4.3 Will ein Bieter Gebote im Namen eines Dritten abgeben, so hat er dies 24 Stunden vor Versteigerungsbeginn unter Nennung von Namen und Anschrift des Vertretenen und unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht mitzuteilen. Im Zweifelsfall erwirbt der Bieter in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.
5. Gebote
5.1 Anmeldungen für schriftliches oder telefonisches Bieten oder Bieten per Internet müssen dem Auktionshaus bis spätestens 18 Uhr am Vorabend der Auktion in schriftlicher Form unter Nutzung der bereitgestellten Formulare vorliegen.
Der Antrag muß die zu bebietenden Objekte unter Aufführung von Katalognummer und Katalogbezeichnung benennen. Im Zweifel ist die Katalognummer maßgeblich.
5.2 Für schriftliche Gebote ist der Biethöchstbetrag zu benennen. Dieser wird von dem Auktionshaus interessewahrend nur in der Höhe in Anspruch genommen, die erforderlich ist, um ein anderes abgegebenes Gebot zu überbieten. Bei gleichlautenden Geboten hat das zuerst eingegangene Gebot Vorrang.
5.3 Für telefonische Gebote ist anstelle des Bietbetrages der Vermerk „telefonisch“ zu benennen. Telefonbieter werden vor Aufruf der benannten Los-Nummern durch das Auktionshaus angerufen. Das Auktionshaus empfiehlt die zusätzliche Hinterlegung eines schriftlichen Biethöchstbetrages als Sicherungsgebot. Dieser wird nur beansprucht, wenn eine Telefonverbindung nach mehreren Versuchen nicht zustande kommt.
5.4 Das Auktionshaus übernimmt keine Gewährleistung für die Übertragung oder Bearbeitung von Geboten oder das Zustandekommen von Verbindungen.
6. Durchführung der Versteigerung, Nachverkauf
6.1 Das Auktionshaus hat das Recht, Nummern des Katalogs zu vereinen, zu trennen, außerhalb der Reihenfolge aufzurufen, zurückzuziehen oder unverkaufte Nummern erneut aufzurufen.
6.2 Der Aufruf beginnt in der Regel unter dem im Katalog genannten Schätzpreis. Gesteigert wird regelmäßig um zehn Prozent. Das Auktionshaus kann andere Steigerungsraten vorgeben, die für den Bieter verbindlich sind. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf an den Höchstbietenden. Geben mehrere Bieter gleichzeitig ein gleichlautendes Gebot ab, entscheidet das Auktionshaus nach eigenem Ermessen. Bei Uneinigkeiten über das Höchstgebot oder Zuschlag kann das Auktionshaus den Artikel erneut aufrufen. Ein erklärtes Gebot bleibt bis zum Abschluß der Versteigerung über das betreffende Objekt wirksam.
6.3 Das Auktionshaus kann ohne Angabe von Gründen den Zuschlag verweigern oder unter Vorbehalt erteilen.
6.4 Gebote, die unter dem Limitpreis liegen, können unter Vorbehalt der Genehmigung des Auftraggebers zugeschlagen werden. Der Bieter bleibt für vier Wochen an sein Gebot gebunden. Das Auktionshaus kann den Artikel ohne Rückfrage zu einem höheren Zuschlag anderweitig verkaufen.
6.5 Unverkaufte Objekte können für zwei Monate nach der Auktion im Nachverkauf erworben werden.
7. Gebotspreis, Aufgeld, Steuern, Abgaben
7.1 Alle Gebote und Zuschläge sind Netto-Preise, in denen das Aufgeld (Käufer-Provision) sowie ggf. Mehrwertsteuer oder Abgaben nicht enthalten sind.
7.2 Für die mehrheitlich differenzbesteuerten Lose wird auf den Zuschlagspreis ein Aufgeld von 25 % erhoben, in dem die Mehrwertsteuer enthalten ist. Diese Mehrwertsteuer wird nicht ausgewiesen.
7.3 Bei Objekten, die als regelbesteuert gekennzeichnet sind, ist auf den Zuschlagspreis zuzüglich eines Aufgeldes von 21,01% die gesetzliche Mehrwertsteuer zu entrichten.
7.4 Auf Grundlage des gesetzlichen Folgerechts (§ 26 UrhG) ist das Auktionshaus bei Verkauf von Werken folgerechtsberechtigter Künstler verpflichtet, an die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst e.V. eine Folgerechtsabgabe in Höhe von z.Z. 4% des Zuschlagspreises zu zahlen. Diese wird dem Käufer hälftig in Rechnung gestellt. Bei bereits erfolgter Rechnungslegung ist das Auktionshaus weiterhin berechtigt, diese Gebühren nachzufordern.
8. Zuschlag, Eigentumsvorbehalt, Zahlungsbedingungen
8.1 Mit Zuschlag kommt der Kaufvertrag zustande und der Zuschlagpreis zuzüglich dem Aufgeld und ggf. der MwSt. sowie aller anfallenden Gebühren werden fällig,
8.2 Das Eigentum an den ersteigerten Gegenständen geht erst mit vollständiger Bezahlung des Endpreises auf den Ersteigerer über (Eigentumsvorbehalt). Der Eigentumsvorbehalt und Rückbehaltungsrecht erstrecken sich auf sämtliche vom Käufer erstandenen Gegenstände und Forderungen gegen diesen.
8.3 Zahlungsmittel ist der Euro. Zahlungen werden nur in bar, per EC-Karte, Bankscheck, Banküberweisung oder per PayPal akzeptiert.
8.4 Schecks werden erfüllungshalber entgegengenommen, ihre Entgegennahme berührt den Eigentumsvorbehalt nicht und die Ware kann in diesem Falle erst nach Eingang des Gegenwertes ausgehändigt werden (frühestens 5 Werktage nach Einreichung des Schecks).
8.5 Aus Zahlungen entstehende Gebühren, Bankspesen oder Kursverluste aus Zahlungen in ausländischer Währung gehen zu Lasten des Käufers.
8.6 Während oder unmittelbar nach der Auktion ausgestellte Rechnungen bedürfen der Nachprüfung; Irrtum bleibt insoweit vorbehalten.
9. Zahlungsverzug, Schadensersatz
9.1 Der Käufer kommt in Zahlungsverzug, wenn er nicht innerhalb von 2 Wochen nach Rechnungsdatum den fälligen Betrag ausgleicht.
9.2 Befindet sich der Käufer in Verzug, so kann das Auktionshaus wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages verlangen oder nach weiteren 7 Tagen vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen.
Einen Monat nach Eintritt des Verzuges ist das Auktionshaus berechtigt und auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, diesem Namen und Adreßdaten des Käufers zu nennen.
9.3 Das Auktionshaus ist berechtigt, neben eigenen auch alle Ansprüche des Auftraggebers gegen den Erwerber gerichtlich oder außergerichtlich geltend zu machen und einzuziehen.
9.4 Tritt das Auktionshaus vom Vertrag zurück, erlöschen alle Rechte des Käufers am ersteigerten Objekt und das Auktionshaus ist berechtigt, 30 Prozent der Zuschlagsumme als pauschalierten Schadensersatz ohne Nachweis zu fordern, das Objekt in einer neuen Auktion nochmals zu versteigern oder anderweitig an Dritte zu veräußern. Der säumige Käufer haftet dabei für jeglichen Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung sowie für die Kosten der wiederholten Versteigerung. Auf einen etwaigen Mehrerlös hat er keinen Anspruch. Zur Wiederversteigerung wird er nicht zugelassen.
9.5 Begleicht ein Käufer fällige Beträge nach zweiter Mahnung nicht, so ist das Auktionshaus berechtigt, seinen Namen und Adresse an andere Auktionshäuser zu Sperrzwecken zu übermitteln.
10. Abnahme der ersteigerten Ware,
Versand, Transport
10.1 Die Gegenstände werden grundsätzlich erst nach vollständiger Bezahlung aller vom Käufer geschuldeten Beträge ausgehändigt.
10.2 Das Auktionshaus kann auf schriftlichen Auftrag des Käufers den Versand der Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers organisieren.
10.3 Mit der Übergabe der Objekte an den Käufer oder einen Spediteur geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung auf den Erwerber über und die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
10.4 Der Käufer kommt in Verzug der Annahme, wenn er die Ware nicht innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum abgeholt oder dem Auktionshaus einen schriftlichen Versandauftrag erteilt oder er mit der Zahlung in Verzug kommt.
10.5 Ab Beginn des Verzuges hat der Käufer die Kosten für Lagerung und Versicherung der Ware in Höhe einer Pauschale von 2,5 % des Zuschlagspreises je angebrochenen Monat zu tragen. Der Anspruch auf die Geltendmachung höherer Kosten oder die Übergabe der Objekte an eine Speditionsfirma zu Lasten des Käufers bleiben vorbehalten.
11. Datenschutzerklärung
11.1 Das Auktionshaus kann die Auktion sowie Biettelefonate zu Dokumentationszwecken aufzeichnen. Mit der Teilnahme an der Auktion erklärt der Bieter dazu seine Einwilligung.
11.2 Das Auktionshaus speichert, verarbeitet und nutzt die die im Rahmen des Geschäftsverhältnisses erhobenen personenbezogenen Daten des Bieters ausschließlich für eigene Geschäftszwecke. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur im Rahmen zwingender gesetzlicher Vorschriften oder für Zwecke der Rechts- oder Strafverfolgung.
11.3 Der Bieter kann einer Speicherung seiner Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen sowie eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten fordern. Er kann auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten erhalten.
11.4 Zur Wahrnehmung des Hausrechtes werden die Geschäftsräume des Auktionshauses videoüberwacht.
12. Schlußbestimmungen
12.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch für das Mahnverfahren, ist Dresden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Dies gilt auch für Schadensersatzklagen aus unerlaubter Handlung, Scheck- und Wechselklagen und wenn der Auftraggeber oder Käufer im Geltungsbereich der deutschen Gesetze keinen Sitz hat oder sein Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
12.2 Der Versteigerungsvertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluß des UN-Kaufrechts.
12.3 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
12.4 Sollte eine der vorstehenden Versteigerungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so tritt an ihre Stelle eine Regelung, die dem Sinn und insbesondere dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht; die Wirksamkeit der übrigen Versteigerungsbedingungen wird dadurch nicht berührt.
12.5 Die Versteigerung von Objekten des Dritten Reiches erfolgen ausschließlich zur staatsbürgerlichen Aufklärung, zu Kunst-, Wissenschafts-, Forschungs- oder Lehrzwecken bezüglich historischer Vorgänge.
Schmidt Kunstauktionen Dresden OHG
Bautzner Str. 99 | 01099 Dresden
Amtsgericht Dresden | HRA 5662
Steuer Nr. 202 / 164 / 24302
Stand 25. Mai 2023